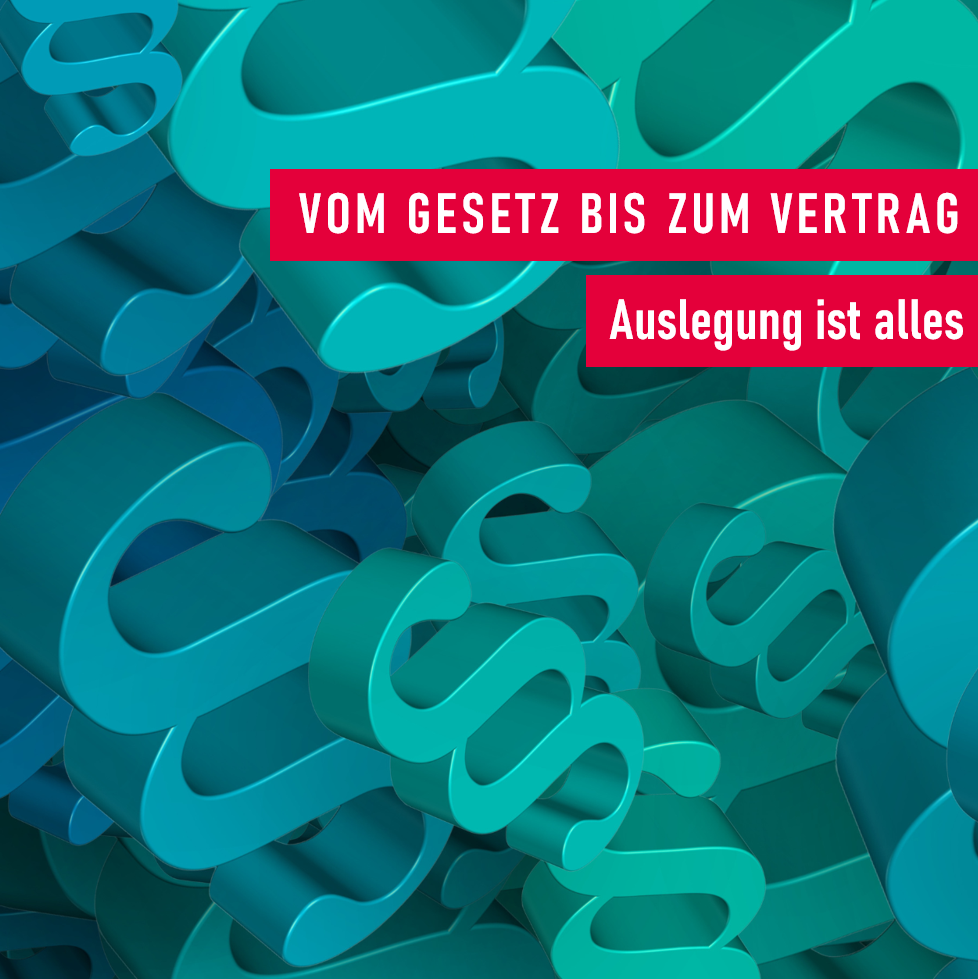Allgemeines Zivilrecht und Vertragsrecht
Wie sind Gesetze, Verträge, Willenserklärungen und andere Klauselwerke eigentlich „zu verstehen“? Die Kunst der Auslegung.
I. Die Auslegung von Gesetzen funktioniert anders als bei Verträgen – und: Gesetz ist nicht gleich Gesetz
Der Wortlaut – man mag es kaum glauben – ist nicht allein entscheidend, auch wenn dieser bei der Gesetzesauslegung eine gewichtige Bedeutung hat. Anders bei strafrechtlichen Normen, für die gilt: Jede vom Wortlaut abweichende Auslegung ist schlicht verboten, denn was nicht als strafrechtlich relevant „in Worten beschrieben“ ist, darf auch nicht hineininterpretiert werden.
Im Zivil- und öffentlichen Recht gilt anderes. Für die Auslegung von Gesetzen – bei Unklarheiten – spielt neben dem Wortlaut auch der Sinn und Zweck der Vorschrift („Was wollte uns der Gesetzgeber damit sagen“), teilweise auch die Gesetzesbegründung (des Gesetzgebers) oder die Historie (wenn auch eher eingeschränkt) eine Rolle.
So hat der Bundesgerichtshof im Zusammenhang mit einer unklaren Norm im Zustellungsreformgesetz ausgeführt:
„… der Bedeutungszusammenhang der Vorschriften …, ihre Entstehungsgeschichte und ihr Sinn und Zweck lassen nur die Auslegung zu, dass …“
Zahlreiche Gesetzesänderungen, gerade im Zusammenhang mit dem Verbraucherschutz (z. B. im Kaufrecht, Fernabsatzverträgen oder Reiserecht), im Arbeitsrecht oder auch im Umweltrecht werden heutzutage durch europarechtliche Vorgaben veranlasst. Während etwa Rechtsverordnungen, die von der Europäischen Union (vom Parlament und Rat gemeinsam) erlassen werden, unmittelbar gelten (sog. Durchgriffswirkung) – und EU-Recht ist höherrangiges Recht, welches also dem nationalen Recht der Mitgliedsstaaten vorgeht – müssen EU-Richtlinien zunächst in nationales Recht (also in deutsche Gesetze) transformiert (umgesetzt) werden. Hierfür sind meistens Fristen für die Nationalstaaten vorgesehen, die manche Staaten nicht immer beachten. Andere Nationalstaaten handhaben die Umsetzung ähnlich wie beim Kauf an der Fleischertheke: Darf es auch ein bisschen mehr sein? Es wird also Zusätzliches „geregelt“, was überhaupt nicht in der EU-Richtlinie zur Umsetzung und Regelung vorgesehen ist.
Problem: Was heute in einem deutschen Gesetz steht, kann als umgesetztes EU-Recht auf den ersten Blick, schon gar nicht für Außenstehende, nicht so ohne weiteres erkannt werden, was aber für eine (korrekte) Auslegung dieser (umgesetzten) europarechtlichen Norm von ausschlaggebender Bedeutung ist, denn europarechtliche Vorgaben in Form von Richtlinien, die Eingang in ein nationales Gesetz gefunden haben, sind nicht nach den üblichen Auslegungsgrundsätzen auszulegen, sondern richtlinienkonform. Allein der Sinn und Zweck, also die Regelungsabsicht der Richtlinie ist das entscheidende Auslegungsmerkmal bei solch transformiertem Europarecht. Wer die Grundlage für das nationale Gesetz nicht kennt bzw. erkennt, wird bei der Auslegung, sofern es hierauf einmal ankommen sollte, scheitern.
II. Auslegung von Verträgen
Ganz anders sieht es dagegen bei der Auslegung von Verträgen aus, denn hier ist vor allem der tatsächliche Wille der Vertragsparteien zu ermitteln.
Selbst wenn beide Vertragspartner den Kaufgegenstand irrtümlich (aber übereinstimmend) völlig falsch bezeichnet haben, kommt der Vertrag – wie von beiden tatsächlich gewünscht – zustande.
Haben die Parteien dagegen völlig aneinander vorbeigeredet und sich über wesentliche Punkte des Vertrages tatsächlich nicht verständigt, gilt der Vertrag als nicht zustande gekommen. Fehlt nur etwas, und hätten die Parteien den Vertrag trotzdem geschlossen, gilt der Vertrag insoweit.
Bei Verträgen gilt zudem § 157 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch), der besagt, dass Verträge so auszulegen sind, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern. Der Wortlaut allein spielt also bei der Auslegung von Verträgen oder einem gerichtlichen Vergleich, der nichts anderes ist, eher eine untergeordnete Rolle. Zum sogenannten Auslegungsmaterial können auch Unterlagen oder sonstige Erklärungen gehören, die in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit dem Vertragsschluss ausgetauscht oder verhandelt worden sind, etwa Prospekte, auf die hin der Vertrag überhaupt erst geschlossen worden ist.
III. Willenserklärungen
Damit ein Vertrag zustande kommt, bedarf es bekanntlich zweier Willenserklärungen, einem Angebot und einer Annahme. Bei Willenserklärungen ist grundsätzlich der wirkliche Wille zu erforschen (§ 133 BGB). Beim Angebot und der Annahme handelt es sich um klassische empfangsbedürftige Willenserklärungen, beim Testament beispielsweise um eine nicht empfangsbedürftige Willenserklärung. Bei letzterer ist ausschließlich der wirkliche Wille des Erblassers zu ermitteln.
Wie dagegen ein Angebot auf Vertragsabschluss „zu verstehen“ ist, ist von einem objektiven Empfängerhorizont aus zu beurteilen.
Es ist daher zu fragen, wie ein objektiv vernünftiger Dritter in der Position des Erklärungsempfängers die Willenserklärung verstanden hätte. In diesem Fall wird also dem „Dritten“ ein besonderes Verständnis oder Sonderwissen zugeordnet, um den objektiven Empfängerhorizont überhaupt bestimmen zu können.
IV. Versicherungsbedingungen
Hier gilt bei der Auslegung das Gegenteil vom wirklichen Willen des Versicherers, der seine Versicherungsbedingungen, ohne mit dem Versicherungsnehmer hierüber verhandelt zu haben, seinem Vertrag zugrunde legen will. Versicherungsbedingungen zählen wie andere „Vertragsklauseln“, die für eine Vielzahl von Fällen vom jeweiligen Verwender, der diese Klauseln seinen Verträgen zu Grunde legen möchte, als Allgemeine Geschäftsbedingungen, die der Inhaltskontrolle nach §§ 305 ff. BGB unterliegen.
Unklarheiten gehen stets zu Lasten des Verwenders. Wird gegen bestimmte Grundsätze der o. g. §§ 305 ff BGB verstoßen, können diese sogar unwirksam sein. Selbst wenn ausnahmsweise die Unwirksamkeit der zugrunde gelegten Klausel einmal den Verwender begünstigen sollte, kann dieser sich hierauf nicht berufen (Strafe muss sein).
Ausgelegt werden Versicherungsbedingungen ausschließlich nach dem Verständnis des durchschnittlichen Versicherungsnehmers, wie dieser die Klausel, ohne irgendein Sonderwissen haben zu müssen, verstehen durfte.
Alles klar?
Hat Ihnen der Beitrag gefallen? Dann teilen Sie ihn doch mit anderen: